
Dr. Nils Friedrichs und Prof. Jannis Panagiotidis: Integration gelungen? Entwicklungen, neue Erkenntnisse und Perspektiven in der Aussiedlerforschung
Integration gelungen? Entwicklungen, neue Erkenntnisse und Perspektiven in der Aussiedlerforschung
Hier können Sie sich diese Folge anhören
„Integration gelungen?“ dieser Frage ist eine im März 2022 veröffentlichte Studie nachgegangen. Sie zeigt, wie es um die Integration und Teilhabe der (Spät-)Aussiedler:innen in Deutschland differenziert nach deren Herkunft in postsowjetischen Staaten, Polen und Rumänien steht. Untersucht wurden unter anderem die politische Einstellung von Russlanddeutschen, deren Zugehörigkeitsgefühle zum Herkunftsland sowie Deutschland, ihr Medienverhalten sowie soziale und kulturell-identifikatorische Teilhabeaspekte. In dieser Folge beschreibt Dr. Nils Friedrichs, Co-Autor der Studie, die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Untersuchung des Sachverständigenrats für Integration und Migration in Kooperation mit dem Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Prof. Jannis Panagiotidis, 2014 bis 2021 Inhaber der Juniorprofessur für Russlanddeutsche Migration und Integration am IMIS ordnet die Entwicklung der Forschung zu dieser Gruppe insgesamt ein und geht den aktuellen Fragen im Kontext des Krieges Russlands in der Ukraine nach.

Ira: Nils, es kursieren in der Öffentlichkeit immer wieder unterschiedliche Zahlen zu der Gruppe der Russlanddeutschen. Wie viele Russlanddeutsche leben in Deutschland und vor allem wer wird hier mitgezählt? Also werden zum Beispiel auch Menschen mitgezählt, die hier geboren worden sind und bei denen nur die Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion stammen?
Nils Friedrichs: In der Studie haben wir sowohl die Russlanddeutschen als auch Spätaussiedler*innen aus anderen Regionen untersucht. Wenn man die Gesamtgruppe nimmt, dann sind es ungefähr 2,6 Millionen, die aktuell in Deutschland leben – nach Angaben des Mikrozensus vom statistischen Bundesamt. Wenn man aber einfach mal alle Personen zusammennimmt, die aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zugewandert sind, dann sind das ungefähr 1,6 Millionen Personen, die mit Spätaussiedlerstatus aktuell in Deutschland leben. In dieser Zahl sind alle selbst zugewanderten Personen drin, die im Rahmen des Aufnahmeverfahrens als Spätaussiedler die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben. Das bedeutet, dass sowohl die in Deutschland geborenen Nachkommen von Spätaussiedler*innen, als auch eventuell mitgereiste Familienangehörige, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten oder angenommen haben, nicht enthalten sind.
Edwin: Wir sprechen immer von ungefähr 3 Millionen. Also 2,4, die selbst zugewandert sind plus ihre Kinder. Der Mikrozensus ist ja keine Bevölkerungszählung und -befragung, sondern eine stichprobenartige Befragung von Menschen nach bestimmten Kategorien. Um wie viele Personen handelt es sich bei diesen Umfragen?
Nils Friedrichs: Beim Mikrozensus werden jährlich ein Prozent der Haushalte befragt.
Edwin: Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie?
Nils Friedrichs: Die erste wichtige Erkenntnis ist, dass die Integration und Teilhabe der Gesamtgruppe sehr gut gelungen ist oder sehr weit fortgeschritten ist. Es ist eine Gruppe, die zeichnet sich aus durch eine hohe Arbeitsmarkbeteiligung, auch was das Einkommen angeht. Da gibt es gewisse Unterschiede innerhalb der Gruppe, aber auch da liegen sie insgesamt im mittleren Bereich. Sie zeichnen sich aus durch sehr gute Deutschkenntnisse, sie haben zahlreiche Kontakte, sowohl zu Personen der eigenen Herkunft als auch zu Deutschen ohne Zuwanderungsgeschichte. Es ist schon eine Erfolgsgeschichte. Wir haben uns nicht nur mit den Russlanddeutschen beschäftigt, sondern auch mit anderen Spätaussiedler*innen und Aussiedler*innen und wir stellen fest, dass in einigen Bereichen die Russlanddeutschen vielleicht noch in einer etwas schwierigeren Situation sind. Das sehen wir zum einen im ökonomischen Bereich, also im Bereich der strukturellen Integration, was sich daran zeigt, dass sie hier einen höheren Anteil an Arbeiter*innen etwa haben. Sie sind auch etwas häufiger in den unteren Einkommenssegmenten vertreten, wenn man das vergleicht mit Deutschen ohne Zuwanderungsgeschichte und auch was die Bildungsabschlüsse angeht. Wenige Leute haben gar keinen Bildungsabschluss. Aber auch der Anteil an Personen mit höheren Bildungsabschlüssen ist geringer, sowohl im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund als auch im Vergleich zu anderen Zugewanderten. Daneben ist der zweite Bereich der politischen Einstellungen. Diese Gruppe ist nicht einfach einzuordnen. Wir stellen fest, dass die Russlanddeutschen insgesamt sich durch etwas weniger Interesse an Politik auszeichnen. Sie sind ein bisschen optimistischer, wenn es um die politische Situation im Herkunftsland geht, aber wiederum etwas zurückhaltender, was die Bewertung der Demokratie in Deutschland betrifft. Das sind Punkte, wo wir sagen können, dass die Russlanddeutschen sich vielleicht nochmal etwas unterscheiden von anderen, also von Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen aus anderen Regionen. Dritter Punkt hängt damit auch wieder zusammen. Man kann die Frage stellen, woran das liegt. Was wir feststellen konnten, ist, dass es zwei wichtige Faktoren gibt. Zum einen das Bildungsniveau. Wir stellen fest, dass die Unterschiede innerhalb dieser Aussiedler-, Spätaussiedlergruppe und auch zu anderen Personen geringer werden, wenn man sich statistisch auf das Bildungsniveau konzentriert. Und ein zweiter Punkt ist, gerade im Vergleich zu Aussiedler*innen, Spätaussiedler*innen, die aus anderen Regionen kommen, dass die insgesamt durchschnittlich kürzere Aufenthaltsdauer eine Rolle spielt. Es zeigt sich, wie stark Integration auch eine Frage der Zeit ist.
Ira: In einem Kapitel habe ich gesehen, dass ihr die Verbundenheit der Russlanddeutschen mit Deutschland und dem Herkunftsland untersucht habt. Was kam denn dabei heraus?
Nils Friedrichs: Die Verbundenheitsfrage ist wahrscheinlich bei dieser Zuwanderungsgruppe sogar besonders wichtig, weil die Zugehörigkeit zu Deutschland ein wesentlicher Aspekt und Grund der Migration war. Was wir feststellen in unseren Daten und das unterscheidet sich tatsächlich auch ein bisschen von Ergebnissen, die teilweise in anderen Untersuchungen herausgefunden wurden, dass sich die Gruppe der Russlanddeutschen überdurchschnittlich stark mit Deutschland, aber auch mit dem Bundesland und der Kommune, in der man lebt, identifizieren. Das sind mit Deutschland und mit der Kommune über 90 Prozent. Und jeweils 92 Prozent, die sagen, sie fühlen sich eher oder sehr zugehörig. Beim Bundesland sind es mit 86 Prozent kaum weniger, die das angeben und damit unterscheiden sie sich auf jeden Fall von anderen Zugewanderten. Zugleich stellen wir fest und auch das ist speziell, dass sich Russlanddeutsche ziemlich wenig mit ihrem jeweiligen Herkunftsland verbunden fühlen. Auch gerade, wenn man das mit anderen Zugewanderten vergleicht, bei denen das viel stärker der Fall ist. Konkret sieht es so aus, dass sich gerade mal ein Drittel eher oder sehr dem Herkunftsland zugehörig fühlt. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Herkunftsländern. Diejenigen, die aus der Russischen Föderation stammen, da geben etwa 45 Prozent an, dass sie sich mit ihrem Herkunftsland verbunden fühlen. Die Werte sind etwas höher als bei Personen aus anderen Ländern. Fast 60 Prozent sagen, dass sie sich nur Deutschland zugehörig fühlen. Ungefähr ein Drittel sagt, sie fühlen sich mit beiden Ländern eng verbunden. Personen, die sich mehrheitlich oder fast ausschließlich mit dem Herkunftsland verbunden fühlen, sind laut unseren Daten gerade einmal vier Prozent.
Edwin: Hast du eine Erklärung dafür, woher das kommt, dass sich so wenige mit ihrem Herkunftsland identifizieren?
Nils Friedrichs: Ja, wir haben ein paar Ideen. Ein Punkt ist mit Sicherheit, dass ja auch die Lebensbedingungen der Menschen, insbesondere der Russlanddeutschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, nicht unproblematisch waren, da die Menschen Diskriminierungen, Benachteiligungen ausgesetzt waren und das das Verhältnis zu dem Land, aus dem man ausgewandert ist, negativ beeinflusst. Ansonsten hat es, auf Basis unserer Daten, zu tun mit dem sozialen Kontext, der sozialen Einbettung in Deutschland, die unseren Daten zufolge gut gelungen ist. Sie pflegen sehr viele Freundschaften zu Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte. Wir stellen fest, die Verbundenheit mit Deutschland ist umso stärker, je stärker man Freundschaften pflegt mit Deutschen ohne Migrationshintergrund. Aber auch die Sprachpraxis ist wichtig, je mehr Deutsch im Alltag gesprochen wird, desto höher ist die Identifikation. Und auch das ist plausibel: Je weniger Diskriminierungserfahrungen man macht, desto zugehöriger fühlt man sich. Umgekehrt stellen wir fest, dass wer sehr viele Freundschaften mit Personen der eigenen Herkunft pflegt, eher dazu neigt, sich stark mit dem Herkunftsland verbunden zu fühlen.
Ira: Ich würde hier vielleicht noch aus meiner Familie ergänzen. Wir sind Anfang der 1990er aus der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan nach Deutschland ausgewandert. Die Zustände damals was zum Beispiel die Kriminalität angeht waren wirklich schwierig. Mit diesen Gefühlen hast du dieses Land verlassen. Ich glaube, dass es für meine Eltern auf jeden Fall auch ein Mitgrund ist, warum sie sich mit Kasachstan überhaupt nicht verbunden fühlen. Wie ist es denn bei dir, Edwin?
Edwin: Allein die Perspektive, dass man für immer nach Deutschland ausgesiedelt ist, sie nabelt einen von dem Herkunftsland ab. Also diese Bleibeperspektive, verbunden mit der deutschen Staatsbürgerschaft, die man per Status als Spätaussiedler erhalten hat. Insofern glaube ich, gibt es weniger Bezüge zum Herkunftsland. Das Interessante, was ich in der Studie auch gelesen habe, ist auch der Unterschied zu anderen Gruppen, die sich nochmal weniger mit ihren Herkunftsländern identifizieren als zum Beispiel die Aussiedler aus Rumänien oder Polen. Die Erklärung war, dass diese Länder jetzt auch Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind und dass man sich so mit den Gesellschaften und demokratischen Strukturen in diesen Ländern leichter identifizieren kann, als zum Beispiel die Aussiedler, die aus der Russischen Föderation oder aus Kasachstan gekommen sind.
Ira: In eurer Studie habt ihr auch untersucht, wie es um den Medienkonsum und das Medienvertrauen in dieser Gruppe steht. Was ist euch da aufgefallen?
Nils Friedrichs: Zum Medienkonsum, da haben wir nach verschiedenen Mediengattungen gefragt und danach, in welcher Sprache diese Medien vorwiegend konsumiert werden. Wir haben nicht nach konkreten Radiosendern oder Fernsehsendern gefragt. Da kommt raus, das gilt für alle Zuwanderergruppen, dass sie Medien vorwiegend mit deutscher Sprache konsumieren und die jeweilige Herkunftssprache vergleichsweise selten nutzen. Das ist allerdings bei Spätaussiedler*innen besonders ausgeprägt. Sie nutzen besonders selten Medien in der Herkunftssprache, was zum Teil dem widerspricht, was man in öffentlichen Debatten dazu findet. Bei den Russlanddeutschen als Teilgruppe der Aussiedler*innen oder Spätaussiedler*innen stellen wir fest, dass um die 15 Prozent angegeben haben, dass sie soziale Medien oder auch Fernsehen bzw. Online-Fernsehen vorwiegend in der Herkunftssprache nutzen. Das ist vergleichsweise wenig. Daneben haben wir uns mit Fragen zum Medienvertrauen beschäftigt. Da haben wir danach gefragt, inwieweit man den Medien in Deutschland, aber auch Medien im jeweiligen Herkunftsland Vertrauen entgegenbringt. Den deutschen Medien wird deutlich stärker vertraut als den Medien des Herkunftslandes. Auch das ist etwas, was sich bei anderen Zuwanderergruppen beobachten lässt, was aber erneut bei russlanddeutschen Spätaussiedler*innen etwas ausgeprägter ist. Ganz generell stellen wir fest, dass das Medienvertrauen in deutsche Medien bei ungefähr 60 Prozent liegt. Bei dem Vertrauen in die Medien des jeweiligen Herkunftslandes ist das ungefähr ein Viertel. Das gilt sowohl für die Russlanddeutschen als auch für andere Aussiedler*innen. Bei Personen, die aus der Russischen Föderation stammen, ist der Wert ein bisschen höher. Da sind wir bei ungefähr einem Drittel, die angeben, dass sie den Medien des Herkunftslandes vertrauen. Wenn wir darüber diskutieren, ob es eine bestimmte Offenheit für Propaganda oder bestimmte Manipulationen gibt, dann müsste man sagen: Es gibt eine Teilgruppe, die dafür eventuell empfänglich ist, aber unseren Daten zufolge ist das auf jeden Fall eine Minderheit. Wir haben auch eine Frage gestellt zum Verhältnis der Unabhängigkeit von Medien und Staat. Da kam tatsächlich raus, dass über die Hälfte der Russlanddeutschen eher oder sehr der Ansicht ist, dass die Medien und die Politik in Deutschland zusammenarbeiten, um die Bevölkerung zu manipulieren. Eine Aussage, die ein bisschen in eine verschwörungstheoretische Richtung geht. Allerdings muss man sagen, dass auch in der generellen Bevölkerung, da sind wir auch immer um die 40 Prozent, die dem zustimmen. Es ist generell eine gewisse Medienskepsis verbreitet, bei den Russlanddeutschen ist sie ein bisschen größer.
Edwin: Das Konsumieren von Medien aus den Herkunftsstaaten hat per se nichts Verruchtes oder Gefährliches, sondern wir konsumieren ja auch russischsprachige Medien, um zu verstehen, was dort passiert. Wenn aufgeklärte Menschen da mit einem gesunden Maß an Kritik und Selbstkritik, an diesen Konsum herangeht, dann ist es bereichernd für unsere Gesellschaft. Denn wir haben hier sehr viele Menschen, die unmittelbar die Gesellschaften auch einschätzen können und Informationen transportieren können. Dass ungefähr ein Viertel den Medien aus den Herkunftsländern auch Vertrauen schenkt, ist natürlich eine Herausforderung, mit der wir in Zukunft umgehen müssen.
Nils Friedrichs: Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Medienkonsum an sich gar kein Problem ist. Also schwierig kann es potenziell werden, wenn wir über Länder sprechen, wo wir wissen, dass eine sehr starke staatliche Kontrolle herrscht und man dann ausschließlich in so einer Bubble dann nur diese Medien konsumiert.
Edwin: Ihr habt auch Untersuchungen zum Wahlverhalten gemacht und dabei über die politischen Einstellungen von Russlanddeutschen Aussagen getroffen. Was waren da die wichtigsten Erkenntnisse?
Nils Friedrichs: Wenn man sich die politischen Einstellungen anguckt, dann ist das nicht leicht, das auf einen Nenner zu bringen. Ganz grundsätzlich kann man sagen, das gilt für Russlanddeutsche wie auch für andere Aussiedler*innen, dass grundsätzlich ein hohes Institutionenvertrauen in Deutschland herrscht, auch ein hohes Vertrauen in Politik und in Parteien. Zwar haben wir auch eine gewisse Skepsis gegenüber Parteien, aber das finden wir bei allen befragten Gruppen. Sie sind mit der Demokratie in Deutschland ein bisschen weniger zufrieden als Aussiedler*innen aus anderen Herkunftsregionen und auch als andere Zugewanderte, aber insgesamt ganz klar von der Demokratie überzeugt. Was vielleicht die Gruppe insgesamt auszeichnet: Gerade die Russlanddeutschen sind eigenen Angaben nach politisch weniger interessiert. Wobei das sehr stark zwischen unterschiedlichen Bildungsgruppen variiert. Und sie trauen sich insgesamt etwas weniger politische Kompetenz und politische Sachkenntnisse zu. Trauen sich weniger zu, Sachverhalt angemessen zu bewerten und in der Tendenz eher so was haben, dass sie stärker dazu neigen, die Verantwortung bei den Politiker*innen zu sehen und da auch ein gewisses Vertrauen haben. Was das Wahlverhalten angeht, also man muss dazu sagen, ich glaube, Wahlverhalten, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig auf Basis unserer Daten, weil wir nicht konkret gefragt haben, wie die Personen bei einer Wahl in einem bestimmten Jahr abgestimmt haben, sondern wir eher nach Parteipräferenzen gefragt haben, wo man zumindest theoretisch davon ausgeht, dass die eine etwas höhere Stabilität haben. Was die Parteipräferenzen angeht, würde ich mit Vorsicht sehen wollen, da die Daten dazu sind auch schon ein bisschen älter sind. Aus früheren Studien weiß man, dass eine überdurchschnittlich hohe Tendenz zu den Unionsparteien besteht, was wahrscheinlich auch ein Stück weit historisch bedingt ist, da das Parteien waren, die damals sehr stark diese Zuwanderung unterstützt und gefördert haben. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass die Russlanddeutschen eine höhere Präferenz für die Partei Die Linke und auch für die Alternative für Deutschland haben, sodass man insgesamt sagen kann, dass Parteien, die zumindest auch teilweise die Gruppe der Russlanddeutschen aktiv adressieren, sie durchaus als Wähler*innen haben. Wobei wir da zumindest auf Basis der Studie keine kausalen Zusammenhänge angeben können. Wir können feststellen, dass die Parteien, die Sie ansprechen, unseren Daten zufolge auch stärker präferiert werden.
Edwin: Also, wenn das Ergebnis ist, dass ein großer Teil nicht wählen geht und der Teil, der wählen geht, dann die Ränder wählt, heißt das, dass dann die populistischen Randparteien mehr Erfolg bei der Ansprache für diese Zielgruppe haben?
Nils Friedrichs: Es geht um die Frage, je größer die Gruppe der Nichtwähler*innen ist, desto schwieriger ist es Aussagen über die politischen Einstellungen der Gesamtgruppe zu treffen. Und die Frage, ob man dann sagen muss, dass die diese Tendenz zu den Rändern deswegen auch gar nicht repräsentativ ist, weil man ja im Prinzip die Gruppe der der Nichtwähler*innen hat. Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es ist ja nicht so, dass ein Viertel, für die Linkspartei und ein Viertel, für die AfD stimmt, sondern die stimmen häufiger für diese beiden Parteien, als das die anderen Gruppen tun. Für die Linke sind es 14 Prozent und für die AfD waren es 12. Also dann reden wir von 12 und 14 Prozent, die sie wählen. Das ist mehr als in den anderen Gruppen. Aber das ist ja nicht die Majorität. Die meisten wählen eben immer noch CDU/CSU. Insofern muss man sagen, es gibt eine gewisse Tendenz zu den Rändern, die wir empirisch feststellen können. Aber das ist nicht der Mainstream der Russlanddeutschen. Und man kann natürlich die Frage stellen: Gibt es tatsächlich eine gewisse Tendenz zu den Rändern oder zu extremeren Positionen oder ist das schlichtweg ein Effekt, dass diese Parteien diese Gruppe ansprechen? Also würden die Sozialdemokraten, würden die Grünen, würden die Liberalen, aktiv Russlanddeutsche ansprechen, wären Sie dann ähnlich erfolgreich? Das wäre tatsächlich eine offene Frage. Möchte man diese Zielgruppe stärker erreichen, dann ergibt es in jedem Falle Sinn, sie auch aktiv anzusprechen.
Ira: Nils, vielen Dank. Ich freue mich wirklich, dass es diese Studie gibt. Ich hoffe, es wird auch künftig Studien über Russlanddeutsche geben. Das ist ein Thema, über das wir gleich auch mit Jannis Panagiotidis sprechen werden.
Edwin: An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für dieses Thema interessieren, diese Studie ist frei zugänglich und zum Runterladen wie auch alle anderen interessanten Studien verfügbar. Im Übrigen auf der Seite des SVR und des BAMF gibt es auch andere Studien. Insofern gibt es Grundlagen, auf denen man Aussagen treffen kann. Hier auch eine Message an Medienvertreter.
Ira: So, und jetzt hören wir das Gespräch, das wir mit Jannis Panagiotis gestern geführt haben. Hallo Jannis, nach Wien. Die meisten von euch kennen Jannis Panagiotis wahrscheinlich bereits. Er leitete von 2014 bis 2021 die Juniorprofessur „Migration und Integration der Russlanddeutschen“. Aktuell ist er an der Universität Wien, als stellvertretender Leiter des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen. Autor vieler Studien und Werke zum Thema Integration und Migration von Menschen aus den postsowjetischen Staaten und hat sich vor allem mit den Russlanddeutschen viel beschäftigt.

Edwin: „Auffällig unauffällig“ war die Diagnose für russlanddeutsche Aussiedler, aber auch Aussiedler insgesamt vor ungefähr zehn Jahren. Da erschien der erste Forschungsbericht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und das war der Aufhänger in der Einleitung. Lag es vielleicht am mangelnden Interesse, diese Zuwanderungsgruppe wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen? Bzw. zu welchem Problem kann es denn führen, wenn sich die Mehrheitsgesellschaft, Öffentlichkeit, Wissenschaft sich wenig mit einer bestimmten Gruppe, in dem Fall mit den Russlanddeutschen bis dahin auseinandergesetzt hat?
Jannis Panagiotidis: Ja, das ist dieses Motto, „auffällig unauffällig“, was seitdem vielfach zitiert wurde. Das hat seinen Grund vor allem in den Daten zur sozioökonomischen Integration, die 2013 überraschend gut aussahen. Das hatte lange Zeit in den 90ern und frühen 2000er Jahren nicht so ausgesehen. Da gab es massive Probleme mit der Integration auf dem Arbeitsmarkt und eben auch gefühlte oder tatsächliche Probleme in der gesellschaftlichen Integration. Also da waren die Russlanddeutschen alles andere als unsichtbar. Und dann sind aus der Wahrnehmung verschwunden, und tauchten wieder auf, und auf einmal waren die Daten eigentlich gar nicht so schlecht. Zum Teil relativ nah an dem Niveau der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Diese Auffälligkeit war in diesem Sinne zu verstehen. Wobei man sagen muss, dass der damalige Bericht, und das wird ja in dem aktuellen in der aktuellen Studie auch durchaus eingeräumt, eben noch nicht in der Lage war, zwischen Russlanddeutschen und Aussiedlern aus anderen Staaten, insbesondere aus Polen und Rumänien zu differenzieren. Das trug nämlich auch zu diesem Bild bei, weil die Aussiedler aus Polen und Rumänien in der Regel im Schnitt deutlich länger hier lebten als die meisten Russlanddeutschen. Gerade im Fall der Rumäniendeutschen, die mit sehr viel besseren Voraussetzungen, vor allem in sprachlicher Hinsicht, das Bild nach oben hin verzerrten. Diese Differenzierung wird es in dem aktuellen Bericht sehr viel stärker vorgenommen und ist wichtig.
Was macht es, wenn über eine Gruppe wenig redet? Dieses Bild, das aus dem Interesse nach den Schreckensmeldungen der 90er Jahre über die entwurzelten Jugendlichen und über die Kriminalität entstand, blieb unkorrigiert erstmal im Raum stehen. Es gab nur diese schlechten Nachrichten, dann gab es keine Nachrichten, dann gab es kurz ein paar gute Nachrichten, dann kam aber auch schon die Krim-Annexion mit entsprechenden politischen Verwerfungen in der Community: der Fall Lisa und der vermeintliche russlanddeutsche AfD-Komplex. Es standen auch wieder viele schlechte Nachrichten im Raum. Und jetzt haben wir eigentlich so ein uneindeutigen Bild. Einerseits ist die Realität selten besonders eindeutig. Andererseits, was setzt sich in den Köpfen fest und was entsteht eigentlich für ein mediales und öffentliches Bild, wenn es viele Bilder und narrative aber wenig gesichertes Wissen gibt? Und von daher ist es wichtig, dass es eben so etwas wie diese Studie gibt oder auch in aller Bescheidenheit meine eigene Forschung gibt, um eben den Narrativen auch Wissen entweder entgegenzusetzen oder aber bestimmte Narrative mit Wissen zu unterfüttern. Das kann durchaus beides sein.
Ira: Die Juniorprofessur, für die du zuständig warst, war an einem Institut für Integration und Migrationsforschung angeschlossen. Was waren denn die Schwerpunkte und warum wurde es so gewählt, dass sie an diesem Institut angegliedert war? Und wie konnte das Forschungsfeld durch deine Arbeit und durch die Arbeit deines Nachfolgers Hans Christian Petersen aktualisiert werden?
Jannis Panagiotidis: Diese Stelle hatte einerseits den Anspruch, historisch zu arbeiten, andererseits den Anspruch Aussagen über die Gegenwart zu treffen. Das habe ich in meiner Forschung versucht zu vertreten und ich denke auch ganz erfolgreich vertreten. Zum Beispiel habe ich mich historisch mit den Nachkriegsmigrationen von Deutschen aus der Sowjetunion und speziell aus der Ukraine befasst, die ja tatsächlich in ihrem Großteil, nicht wie die Wolgadeutschen 1941 kollektiv deportiert wurden, sondern in vielen Fällen unter NS-Besatzung kamen, dann auch nach Westen flohen bzw. umgesiedelt wurden und dann zum großen Teil am Ende des Krieges in die Sowjetunion zwangsrepatriiert wurden, zum Teil aber auch im Westen blieben. Das Spannende für mich war zu schauen, was mit denen passierte, die im Westen geblieben sind, weil viele von denen tatsächlich nach Übersee emigriert sind, wo es ja schon Communities gab, insbesondere in Kanada, in den USA, aber auch in Südamerika, gerade im Fall der mennonitischen Gemeinden. Der Schwerpunkt der Arbeit hat sich dann aber doch relativ stark in die Gegenwart verlagert. Man könnte sagen, auch ein bisschen durch die Ereignisse getrieben. Als ich 2014 diese Stelle antrat, da war es in dem Bereich recht ruhig. Es gab relativ wenig Forschung dazu. Aber es gab auch zumindest auf Grundlage dieses Forschungsberichts von 2013 den Anschein als sei die Integrationslage recht ruhig Dann kam, wie angesprochen, der Fall Lisa, der die Fragen nach der politischen Partizipation und der politischen Verwerfungen in der Community aufs Tableau brachte. Dann habe ich vor dem Hintergrund dieser Ereignisse angefangen, mich mit solchen Fragen zu befassen: Wie wählen die denn jetzt tatsächlich? Und habe mich an empirischer Wahlforschung versucht. Gleichzeitig habe ich angefangen viel mit dem Mikrozensus zu arbeiten - tatsächlich mit quantitativen Quellen, wirklich mit Zahlen, mit Statistiken, und habe das dann immer wieder kombiniert. In meinem Buch Postsowjetische Migration in Deutschland, das letztes Jahr erschienen ist, fließt das alles zusammen. Im Grunde ist es eine Mischung aus Analysen zur sozioökonomischen Integration und zur räumlichen Integration. Also die konkrete Frage, „Wo leben denn eigentlich die Russlanddeutschen, wo leben insgesamt die Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion?“ Sehr interessantes räumliches Verteilungsmuster, das sich beispielsweise sehr stark von anderen Migrantengruppen unterscheidet. Aber auch die Fragen von Identität, die in der Forschung ja immer viel, vielleicht sogar ein bisschen zu viel, diskutiert worden waren. Es ging um Fragen von Politik. Es ging um Fragen von Diskriminierung, was in diesem Zusammenhang ein tendenziell unterbelichtet Thema gewesen war. Und es ging generell um lebensweltliche Fragen. Also einfach was es für Milieus gibt und in was für Settings leben eigentlich die Menschen. Um auch aus diesem homogenisierenden Diskurs, der ja vor allem medial erzeugt wird, rauszukommen. Ja, „Berlin-Marzahn“, „MixMarkt“, also dieses Bild vom in Anführungszeichen „Russenghetto“ an den Peripherien der Stadt, das schon einen Teil der sozialen Realität beschreibt aber der Heterogenität der Communities nicht gerecht wird. Insofern bestand die Aktualisierung des Forschungsfeldes darin, all diese Dinge mal zu machen, um ein paar gewisse Grundlagen zu schaffen. Es ist nicht so, dass bis dahin gar nichts gemacht worden war. Das würde vielen Kolleginnen und Kollegen Unrecht tun. Aber es gab sehr viele Lücken, die zu füllen waren und die jetzt zumindest bis auf weiteres erst mal gefüllt sind und wo wir nun eine Grundlage haben, da auch weiterzumachen.
Edwin: Du warst auch im Wesentlichen derjenige, der einen breiteren Begriff versucht hat zu etablieren, den der postsowjetischen Migranten. Welche Vorteile hast du dir denn daraus abgeleitet?
Jannis Panagiotidis: Der Begriff „postsowjetische Migranten“, der hat für mich den Vorteil, dass er eigentlich von niemandem als Eigenbezeichnung verwendet wird. Ein bewusst von außen aufgepfropftem Begriff, was aus einer analytischen Perspektive hilfreich ist. Es gibt zwar durchaus Leute, die daran Anstoß nehmen, aber es ist ein relativ neutraler Begriff. Es ist neutraler, als zum Beispiel „Russischsprachige“, was ja ein häufig benutzter Begriff ist, der aber durchaus auf Ablehnung trifft, weil er stark mit ethnisch Russischsein assoziiert wird und weil er auf viele, gerade der jüngeren Generation nicht mehr zutrifft. Wenn man nur über Russlanddeutsche redet, also mit der Betonung auf Deutsche, dann lässt man den nicht unbeträchtlichen Anteile dieser Community, die keine deutschen Vorfahren haben, die oft zitierten Familienangehörigen eben auch außer Acht. Und man kriegt drittens eben auch noch andere Communities in den Blick, wie beispielsweise die jüdischen Kontingentflüchtlinge, wie aber auch andere Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die durchaus mit diesen zahlenmäßig schon sehr dominanten Spätaussiedlercommunity in Verbindung stehen und gemeinsame Milieus bilden. All das kriegt man so in den Blick, wenn man die Perspektive etwas erweitert.
Ira: In letzter Zeit werden wir oft gefragt, wie Russlanddeutsche eigentlich zu dem Krieg Russlands gegen die Ukraine stehen. Da ist es immer schwierig, ohne Datenbasis zu argumentieren. Ich beantworte die Frage immer mit meinen Beobachtungen aus dem Umfeld. Gibt es dazu erste Meinungsumfragen oder eine Tendenz? Und was nimmst du in der Community wahr?
Jannis Panagiotidis: Ja, das ist in den letzten Wochen tatsächlich die heiß diskutierte Frage gewesen. Ich meine, ich argumentiere einerseits also mit Beobachtungen aus der Community, auch von Leuten wie euch beispielsweise, die da irgendwo am Puls der Zeit und am Puls der Communities sind, aber auch von anderen Leuten, was durchaus ein zum Teil fast widersprüchliches Bild eigentlich ergibt. Oder zumindest ein sehr heterogenes Bild an Stimmungen, die dort existieren. Es gibt ein paar Daten. Schon kurz nach Beginn des Krieges gab es vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eine Schnellumfrage, die unter anderem danach fragte, wie Leute, mit verschiedenen Migrationshintergrund und auch ohne Migrationshintergrund den Krieg wahrnehmen und welche Maßnahmen dagegen sie unterstützen und wem sie die Schuld daran geben. Darunter auch Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, speziell aus Russland. Und da stellt man fest, dass die Unterschiede zur Gesamtbevölkerung gar nicht so gewaltig sind. Es gibt dort eine Mehrzahl von 80 bis 90 Prozent, die den diplomatischen Druck auf Russland unterstützen. Auch Wirtschaftssanktionen werden von ungefähr Dreivierteln unterstützt. Waffenlieferungen deutlich weniger und militärisches Eingreifen nicht. Aber da sind auch insgesamt alle skeptisch. Heißt aber, dass es eine Mehrzahl wäre, die den Krieg unterstützt, die Russland unterstützt, die Putin unterstützt. Je nachdem, wen man, in den Communities fragt, sagen eben manche: Ja, also in meinem Umfeld sind es aber schon sehr, sehr viele. Andere sehen das aber anders und diese Zahlen würden eben nahelegen, dass diese anderen richtig liegen. Also, es ist keine Mehrzahl, die den Krieg unterstützt. Es ist aber auch keine verschwindende Minderheit. Es ist eine existente, substanzielle Minderheit. Und es ist an vielen Stellen, gerade wenn wir über die „berühmten“ Autokorsos reden, eben auch eine laute Minderheit, die wahrgenommen wird. Und diese Wahrnehmung ist im Zweifel eben sehr relevant.
Edwin: Im aktuellen Studienbericht des SVR wird anhand des Integrationsbarometers nach den Rassismuserfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund gefragt, aber hier in dem speziellen Fall auch der Spätaussiedler und nochmal speziell runtergebrochen der russlanddeutschen Spätaussiedler bzw. denjenigen aus den postsowjetischen Staaten. Und danach ergibt diese Umfrage, dass etwa 9 Prozent sich in der Vergangenheit diskriminiert gefühlt haben oder bzw. sich hier in der Mehrheitsgesellschaft eher schlecht behandelt gefühlt haben. Das war aber eine Umfrage vor dem Krieg. Sprechen wir hier von einem Normalzustand und sind das diese 9 Prozent, die wir auch heute hören?
Jannis Panagiotidis: Das ist wirklich eine spannende Frage nach der Diskriminierungserfahrungen und den Diskriminierungswahrnehmung. Tatsächlich ist es so, und das ist wichtig zur Einschätzung der Gesamtlage, dass diese angesprochenen Autokorsos zumindest nominell nicht für den Krieg oder für Putin demonstrieren, sondern gegen Diskriminierung. Und dieses Gefühl, diskriminiert zu sein, Russophobie zu erleiden, angefeindet zu werden, das wird in der Community seit Kriegsbeginn eigentlich auch geschürt. Und es gibt deutliche Indizien dafür, dass es von interessierten Kreisen - von rechten Kreisen, von russischen Kreisen - gezielt geschürt wird, um ein Gefühl der Verunsicherung zu erzeugen. Man kann davon ausgehen, dass diese 9 Prozent, die sich schon diskriminiert fühlten, da vermutlich auf jeden Fall ansprechbar sind. Mein Eindruck ist aber, dass es weiter als das geht. Ich glaube die Verunsicherung sitzt bei Menschen tiefer, die sich bereits in den 90er Jahren nicht akzeptiert gefühlt haben. Auch die vielleicht in letzter Zeit sich nicht diskriminiert gefühlt haben, aber sich erinnern. Damals wurde man schief angeschaut, wenn man Russisch spricht. Heute wird man wieder schief angeschaut, wenn man Russisch spricht. Dann können solche Sachen wieder hochkommen. Das bedeutet nicht, dass die alle deswegen entweder Putin unterstützen oder zur russischen Botschaft rennen, um ihr Leid zu klagen oder an Autokorsos teilnehmen. Aber diese Verunsicherung, die geht auf jeden Fall tiefer. Und da sind dann diese 9 Prozent, die sich vor dem Krieg diskriminiert gefühlt haben, glaube ich, ein Minimum und man muss jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen vergrößern.
Ira: Du hast dich in letzter Zeit dafür öffentlich eingesetzt, dass man den Antirassismus- und Antidiskriminierungsdiskurs um den Aspekt des Antislawismus erweitert. Also Antislawismus meint Anfeindungen gegen Menschen, die als Slawinnen, als Slawen gelesen werden. Und in einem Interview für Die ZEIT hattest du das Ganze auch als einen blinden Fleck in der Debatte bezeichnet. Also du hattest gerade schon ein bisschen drauf Bezug genommen, aber vielleicht jetzt noch mal mit diesem Hintergrund. Ist denn das Problem größer als die Zahlen aus dem Integrationsbarometer verraten?
Jannis Panagiotidis: Da muss man zwei Punkte machen. Erstens ist es nicht alles, was jetzt gerade passiert, automatisch mit diesem Komplex Antiislamismus verbunden. Es passiert gerade ein schlimmer Krieg und wenn es da Stimmung gegen Russland gibt, dann hat das Gründe, um es deutlich zu sagen. Das heißt nicht, dass es dann berechtigt ist, Menschen, die man als Russen liest, deswegen zu diskriminieren. Aber wenn es insgesamt eine angespannte Stimmung gibt, dann hat das Gründe, die nicht nur mit tradierten Rassismen und Stereotypen zu tun haben. Aber es ist schon so, dass dann an manchen Stellen doch bestimmte Dinge hochkommen, wo man sagt: Hm, da ist ja wirklich einiges an Antislawismus und auch speziell dann an antirussischen Ressentiments unter der Oberfläche vorhanden, was jetzt hervorkommt. Und was eigentlich schon bestätigt, dass diese 9 Prozent im Grunde nur die Spitze des Eisbergs sind. Beispiele sind, wenn es dann hieß, die alten Leute sich jetzt an 1945 erinnert fühlen, als die Russen kamen und das würde dieses Trauma aufreißen und man denkt: Diese alten Menschen - ohne ihnen ihre Erfahrung absprechen zu wollen - waren aber damals durch NS-Propaganda bezüglich der Angst indoktriniert, die sie vor den Russen zu haben hatten. Und das Bild ist entsprechend auch geformt und wird dann jetzt quasi im Nachhinein legitimiert. Ein anderes Beispiel war diese erstaunliche Aussage von einer deutsch-französischen Politologin bei Markus Lanz, die (dem Sinn nach) sagte: Die Russen, die sehen ja aus wie Europäer, aber kulturell sind das keine Europäer, und deswegen haben sie ein anderes Verhältnis zum Tod und deswegen führen sie diesen Krieg. Und das sind Aussagen, bei denen man sagt: Wow, also das ist ein Beispiel für einen wirklich expliziten Kulturrassismus, das wirklich aufhorchen lässt, weil der so deutlich in der Zeit davor nicht unbedingt artikuliert wurde. Davor war die Meinung, Antislawismus ist wichtig, aber man muss fast ein bisschen graben, um ihn auch wirklich dingfest zu machen. Und jetzt ist es so, dass man die Beispiele auf dem Silbertablett serviert bekommt.
Edwin: Warum müssen wir im Kontext dieses Diskurses die Russlanddeutschen eben als Slawen oder Osteuropäer lesen?
Jannis Panagiotidis: Das ist eine sehr wichtige Frage. Das ist deshalb so, weil der Rassismus generell, die Diskriminierung, die Menschenfeindlichkeit, aber nennen wir es in diesem Fall ruhig beim Namen, weil der Rassismus sein Objekt immer selbst definiert. Das ist völlig unerheblich, was die Menschen über sich denken. Es sind die Rassisten, die ihr Opfer definieren. Und von daher ist es so, wenn Russlanddeutsche, egal wie sie sich selbst bezeichnen, als „Russen“ diskriminiert werden, dann hat das mit Antislawismus zu tun. Dann hat das mit diesem Stereotypen- und Ressentimentkomplex zu tun. Und von daher ist das da zu berücksichtigen. Da interagiert natürlich alles miteinander. Also auch diese Selbstwahrnehmung mit diesen Diskursen. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass die Außenwahrnehmung, sozusagen die Täterperspektive, entscheidend ist. Und so kommen dann diese Menschen, bei denen ja sozusagen kollektiv auch ein Stück weit lange Zeit versucht wurde, sie aus dem Migrationsdiskurs rauszuhalten und erst recht aus irgendeinem Rassismusdiskurs, da dann jetzt eigentlich rein. Nicht weil die das so wollen, sondern weil das sozusagen aus der Außenperspektive dann sinnvoll ist.
Ira: Ich nehme aktuell in der russischsprachigen Community wahr, dass das Vertrauen in deutsche Medien teilweise auch wieder gesunken ist. Oder vielleicht war es schon längere Zeit relativ niedrig und jetzt wird das irgendwie offenbar. Also zumindest bei einem kleinen Teil der Gruppe. Also wenn du jetzt unsere Politikerinnen und Politiker beraten müsstest, was würdest du ihnen denn raten, wie sie das Vertrauen der Russlanddeutschen oder der Russischsprachigen in Deutschland in deutsche Medien erhöhen können oder zurückgewinnen können? Also jetzt auch in Abgrenzung gegenüber russischen Staatsmedien oder den ganzen Inhalten, die über Messengerdienste geteilt werden, wo ganz viel Fake-News-Propaganda dargestellt wird. Und genau an diese Gefühle werden dann bestimmte Inhalte geknüpft, sodass die Menschen dann emotional abgeholt werden. Und dann glauben sie halt alles, was danach folgt.
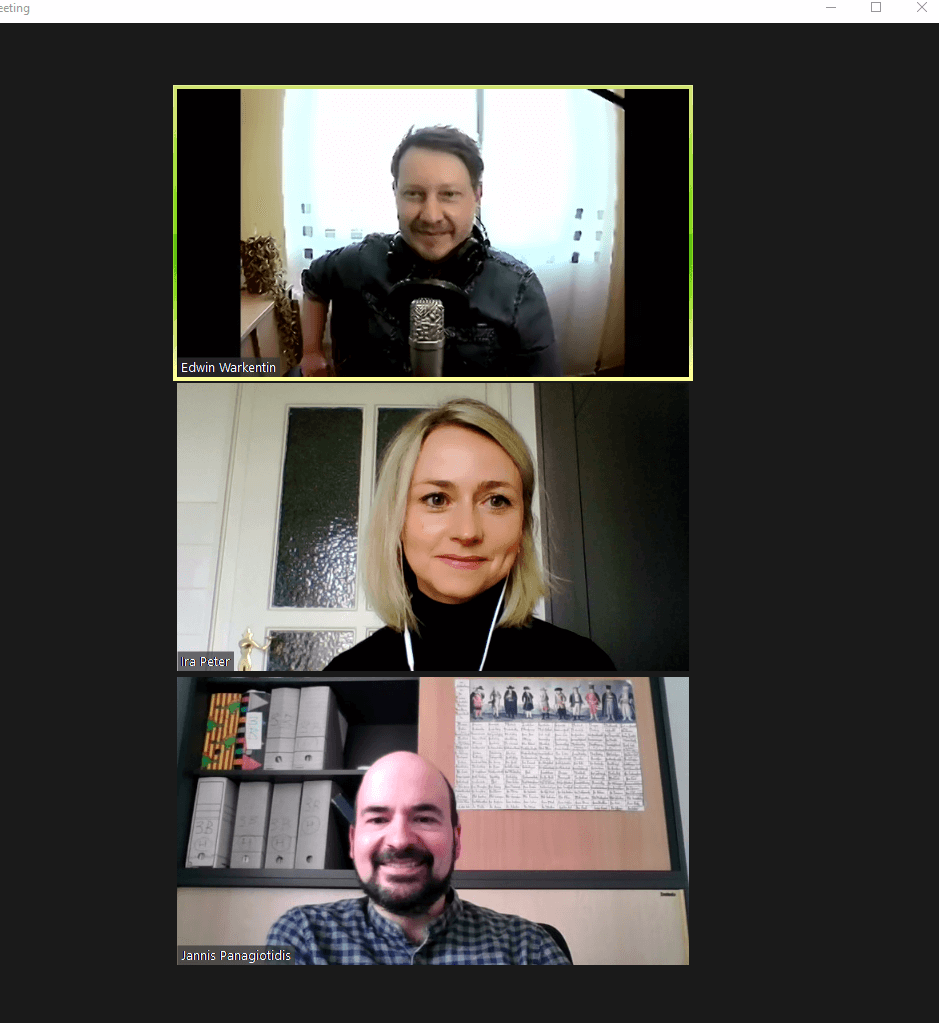
Jannis Panagiotidis: Das ist natürlich die Eine-Million-Euro-Frage. Wenn ich da eine richtig gute Antwort hätte, dann wäre wahrscheinlich vieles besser. Fangen wir mal mit dem an, was vielleicht schon tatsächlich gut funktioniert. Also es gab Versuche, solche Fakes mit angeblichen Mordfällen zu lancieren. Beispielsweise den Fall Daniel in Euskirchen und in Nürnberg gab es jetzt auch noch mal so einen Fall, wo angeblich Russischsprachige ermordet wurden. Das wurde von der Polizei durch klare Kommunikation, dass das Fake ist, offenbar doch ziemlich schnell im Keim erstickt. Anders als der Fall Lisa damals, wo die Polizei zwar auch dementiert hat, aber eigentlich auch rumgeeiert hat. Und das funktioniert jetzt besser. Deswegen ist da jetzt auch erst mal nichts draus geworden. Das funktioniert schon mal gut. Was auch gut funktioniert hat, als diese ersten Meldungen bezüglich vermeintlicher Diskriminierung, Anfeindungen von Russischsprachigen hochkamen, dass die Bundesregierung sehr deutlich Stellung bezogen hat und gesagt hat: So geht das nicht, und dass es nicht um diese Menschen geht und, dass das Russlands und Putins Krieg ist. Was natürlich dann auch wieder eine Simplifizierung ist. Man kann gerade im Bereich der Informationen immer noch mehr machen, da er sehr sensibel ist, und dass es Kommunikationsnetzwerke in russischer Sprache gibt in denen parallele Welten existieren. Das ist ja nicht nur bei den Russlanddeutschen so. Es hat sich jetzt seit zwei Jahren auch so eine Querdenker-Szene etabliert. Ich denke, zum Teil auch in Überschneidung mit vorherigen Strukturen von Pegida und anderen, wo generell alternative Realitäten existieren. Wo es insgesamt schwierig ist dagegen anzukommen. Dennoch wäre es zumindest mal einen Versuch wert, zum Beispiel seitens der öffentlich-rechtlichen Medien auch Angebote in russischer Sprache zu machen. Man macht jetzt die Tagesschau auf Ukrainisch für neuangekommene Geflüchtete, was eine tolle Sache ist. Vielleicht könnte man es auch auf Russisch machen für diejenigen, die schon länger hier leben, aber die nach wie vor irgendwo stärker auf russische Angebote angewiesen sind. Und es ist ja auch so, dass der Konsum von russischen Medien nicht zwingend ein politisches Statement ist, sondern oft auch eine Frage von Bequemlichkeit, von was halt geht, was man mag. Wenn es dazu ein alternatives Angebot gäbe, sozusagen hier einheimisch, wie das zum Beispiel in Israel seit den 90er Jahren völlig normal ist. Da haben sich dann gleich russischsprachige Radiosender, Fernsehsender gebildet, die von Russland unabhängiges russischsprachige Angebot machen.
Edwin: Es geht ja auch nicht um Gegenpropaganda, sondern es geht um einen russischsprachigen Content über europäische und deutsche Themen. Insofern, als dass man eben eine Alternative anbietet, sich über hiesige Realitäten auch in russischer Sprache zu informieren. Und es geht ja nicht nur um die 2,3 Millionen russischsprechende Menschen hier in Deutschland, sondern es geht um eine europaweite russischsprechende Communities, von denen es ja auch in den baltischen Ländern sehr viele gibt, in osteuropäischen Staaten insgesamt. Aber auch in Frankreich oder in Großbritannien gibt es ja diese Menschen. Und wenn es ein europäisches Informationsangebot gäbe, dann wäre es auf jeden Fall gut und nicht im Sinne von einer Gegenpropaganda.
Wie können wir diese Menschen so einfangen, dass sie positive Identifikationswerte mit der hiesigen Gesellschaft oder mit den europäischen Werten gewinnen? Was muss die Mehrheitsgesellschaft eben noch anbieten für diese Menschen, damit sie sagen: Okay, gut, mit dem habe ich jetzt nichts mehr zu tun, ich habe das jetzt irgendwie genug gesehen und ich bin jetzt hier zu Hause, ich lebe hier und meine Zukunft ist jetzt hier.
Jannis Panagiotidis: Das, was wir gerade besprochen haben, sind eher langfristige als kurzfristige Lösungen, weil einfach so ein mediales Angebot, das, wie du ganz richtig sagst, nicht Gegenpropaganda sein soll, sein kann, weil das auch einfach zu plump ist und nicht funktioniert. Aber ein Angebot, das signalisiert: erstens, ihr gehört dazu, auch wenn ihr die russische Sprache sprecht. Und weil du das Baltikum angesprochen hast, wir müssen uns das eigentlich klar machen - das Russische ist eine Sprache der Europäischen Union. Es gibt inzwischen auch anerkannte Minderheiten mit russischer Muttersprache in EU-Staaten. Also von daher ist das Realität. Genauso wie das Türkische eine Sprache der Europäischen Union ist, weil ja Zypern nominell nach wie vor ein bi- oder sogar trilingual Staat ist. Also das sind Realitäten, die aber noch nicht genügend gelebt werden. Viele der Menschen, über die wir hier reden, würden sich ja vielleicht auch trotzdem gar nicht als Russen sehen, empfinden aber trotzdem Loyalitätskonflikte oder auf jeden Fall eine Verunsicherung, weil sie diese sehr unterschiedlichen Narrative hier wie dort erleben. Und wenn man da irgendwo sagt: Okay, man kann sich zumindest schon mal über diese Sprache hier dann auch trotz allem heimisch fühlen, wäre vielleicht schon viel getan.
Edwin: Wir sprechen auch von Menschen, die wahrscheinlich aufgrund ihrer sozialen Situation oder ihrer Lebenslage nach alternativen Narrativen streben und wollen alternative Erklärungen haben. Und von diesen Menschen gibt es ja in unserer Mehrheitsgesellschaft unabhängig von ihrem Hintergrund genug. Es wurde im Zusammenhang mit den PEGIDA-Demonstrationen oder bestimmten Präferenzen für populistische Parteien ja auch sehr viel über die Ostdeutschen gesprochen. Und es geht um bestimmte Mentalitäten oder bzw. auch um Erfahrungen der Menschen der Wendezeit, die aus meiner Sicht sehr ähnlich sind mit den Erfahrungen vieler Aussiedlerinnen und Aussiedler, die eben ihre Sozialisation in einem totalitären sowjetischen sozialistischen Staat hatten und jetzt hier mit diesen Erfahrungen leben. Ist es nicht so, dass hier sehr viele Überschneidungen gibt mit den Ostdeutschen gibt?
Jannis Panagiotidis: Den Vergleich zwischen Spätaussiedlern und Ostdeutschen, den gibt es in dieser Form bisher eigentlich nicht, aber er liegt eigentlich auf der Hand. Darauf hatte ich auch in verschiedenen Publikationen hingewiesen. Wenn man alleine auf das politische Profil schaut, wo man eben bei den Russlanddeutschen feststellt, wenn man mal jenseits dieses Narratives schaut: Ach, die wählen alle AfD. Nein, die wählen nicht alle AfD. Sie wählen tatsächlich schon in überdurchschnittlichem Maße AfD, aber sie wählen auch in überdurchschnittlichem Maße die Linkspartei. Wer tut das noch? Die ostdeutschen Wähler im Schnitt, ja? Und das alles auf Kosten der Volksparteien. Das heißt, wir haben im politischen Verhalten eine sehr augenscheinliche Parallele, wo man eben zumindest die Hypothese aufstellen kann, dass das auch mit bestimmter politischer Sozialisation einerseits, aber auch mit bestimmten Erfahrungen seitdem zu tun hat. Also einerseits hat das mit der Erfahrung des real existierenden Sozialismus zu tun. Interessanterweise ging man bei den Russlanddeutschen in den Neunzigern immer noch davon aus, dass sie das gegen das Linkswählen immunisiere, weil man eben sagte: Na ja, die haben den Kommunismus erlebt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und insbesondere auch im Wandel der Zeit ist es nicht so. Mit Blick auf die Vergangenheit sieht vieles in einem milderen Licht aus. Und gerade die Breschnew-Zeit wird dann ja auch, nicht nur negativ erinnert. Im Gegenteil, das war ja auch eine Zeit von Stabilität. Zastoj wird ja mit Stagnation übersetzt, aber ist ja im Grunde auch eine Stabilität. Und Stagnation ist nichts Schlimmes, wenn man jahrzehntelang vorher verfolgt und erniedrigt wurde. Das heißt, es gibt durchaus positive Anknüpfungspunkte, die dann auch mit den Verwerfungen kontrastieren, die man danach erlebt hat, mit der Zeit nach 1989 oder im Fall der Sowjetunion vor allem nach 1991 - Staatszerfall, wirtschaftlicher Zerfall. Und das ist durchaus eine parallele Erfahrung mit den Bürgern in der ehemaligen DDR. Diese Transformationserfahrung, die eben sehr tief ging. Das Gefühl, dass Lebensleistungen nicht anerkannt werden, wie es ja oft formuliert wird, dass tatsächlich auch hier wie dort tendenziell geteilt wird und ja, dass das Einfinden in neuen wirtschaftlichen politischen Kontext und so weiter. Gleichzeitig das Ringen mit der Frage, was eigentlich die eigene Biografie, die man ja zu großen Teilen eben in diesem real existierenden Sozialismus gelebt hat, was die eigentlich noch bedeutet oder was die eigentlich noch wert ist. All das sind parallele Erfahrungen und ich glaube, es wäre wirklich interessant, die mal systematisch gegenüberzustellen oder eben auch zu vergleichen, miteinander ins Gespräch zu bringen, fände ich im Zweifel produktiver als das, was ja zum Teil jetzt schon versucht wurde, Ostdeutsche mit Migranten insgesamt irgendwo, ich will nicht sagen gleichzusetzen, aber zu sagen, die hätten ja ähnliche Erfahrungen. Da bin ich dann tatsächlich eher skeptisch, weil es weniger nur um Erfahrung von Fremdheit geht, sondern es geht um Situierung der Biografie zwischen zwei politischen und wirtschaftlichen Systemen und die Frage: Was macht man vor allem in der biografischen Perspektive damit.
Edwin: Kurz ein Spoiler: Wir werden zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober mit der Deutschen Gesellschaft e.V. hier in Detmold diesen Fragen nachgehen und es wird zeitnah eine Einladung zu diesem Symposium geben.
Ira: Jetzt ist die Juniorprofessur für Russlanddeutsche erst mal an ihrem Ende, da die Förderung ausgelaufen ist. Ist denn jetzt alles erforscht?
Jannis Panagiotidis: Man denkt immer, dass alles erforscht ist, bis dann die nächste Katastrophe um die Ecke kommt, zu der man dann Stellung beziehen muss. Spaß beiseite, es ist natürlich nicht alles erforscht. Im Gegenteil würde ich behaupten, dass eigentlich jetzt erst mal die Grundlage geschaffen ist, um weitere Forschungen durchzuführen. Mein Buch habe ich mit einem gewissen Bedacht "Eine Einführung“ genannt, wohlwissend, dass es eigentlich mehr als das ist. Es ist eigentlich eine Einführung des Themas. Es ist eine Grundlage für die weitere Erforschung des Themas, insbesondere wenn wir über die lebensweltliche Perspektive reden. Wie leben eigentlich russlanddeutsche und postsowjetische Migranten generell in Deutschland? Was für Erfahrungen machen sie? In was für Milieus leben sie? Das sind ja alles Fragen, auf die es im Endeffekt wenig Antworten gibt. An denen arbeiten wir jetzt zum Teil. Ich mache durchaus weiter. Und ich bin auch Teil des Forschungsverbundes Ambivalenzen des Sowjetischen, der von der Volkswagenstiftung im Rahmen des Niedersächsischen Vorab gefördert wird und wo in verschiedenen Projekten es gerade um diese lebensweltlichen Perspektiven geht. Also ich betreue etwa ein Projekt zur postsowjetischen Immigration in Osnabrück, obwohl ich ja nicht mehr in Osnabrück bin. Aber das ist eine sehr interessante Perspektive, so ein lokales Setting anzuschauen, wo auch sehr unterschiedliche Gruppen zusammenkommen, wo es Russlanddeutsche gibt, wo es auch viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion gibt, wo es Georgier und Aseris und so weiter gibt. Das ist hochinteressant und hochrelevant, weil man da sehr wenig davon weiß. Das kann man mit weiteren Fragen verknüpfen. Beispielsweise generell nach der Bedeutung von Migration im ländlichen Raum. Ich hatte vorher schon die räumliche Verteilung der Russlanddeutschen angesprochen. Die leben zu 80 Prozent in kleinen Städten und den Dörfern. Das heißt, sie leben überwiegend in Räumen, die wir zumindest im wissenschaftlichen Diskurs kaum mit Migration assoziieren, die aber hochinteressant sind und über die man sehr wenig weiß. Und ein dritter Punkt, jetzt kommen die Geflüchteten aus der Ukraine hinzu, mit denen es absehbar sehr viele lebensweltliche Überschneidungen geben wird. Allein über russische Sprache, die ja viele, obwohl sie aus der Ukraine kommen sprechen. Man wird sich in den viel zitierten russischen Supermärkten garantiert treffen. Es gibt allerlei Hilfsinitiativen, Dolmetscher, Dienste usw. Das heißt da kommt jetzt auch eine Bewegung in eine Community hinein, die bis dahin vielleicht statisch wahrgenommen wurde, die dem Thema jetzt eben auch noch mal eine ganz neue Forschungsrelevanz gibt.
Edwin: Das sind ganz interessante Aussichten. Wir haben über kurzfristige, mittelfristige Lösungen gesprochen, aber auf jeden Fall gibt es ja auch Ansätze, wie die Erforschung der Russlanddeutschen in ihren Migrations- und Integrationsverhalten weitergeführt wird. Und was ich sehr interessant an deiner Forschung finde ist, dass du das ja auch durchaus mit historischen Themen verknüpfst und auch im Sinne von Mentalitäten dann auf gemeinsame und kollektive Erfahrung zurückgreifst.
Und noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Jannis Panagiotidis bisher nicht kannten: von ihm erschien im Beltz-Iuventa-Verlag das Buch „Postsowjetische Migration in Deutschland. Eine Einführung“. Und es gibt in der Reihe Informationen für politische Bildung ein Heft Spätaussiedler in der Migrationsgesellschaft. Da ist noch mal alles in einer zugänglichen Sprache, mit schönen Schaubildern und Bildern zusammengefasst.
Ira: Jannis, vielen Dank für deine Expertise. Wir freuen uns noch möglichst viel von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema zu lesen, weil auch wir natürlich der Meinung sind, dass noch lange nicht alles erforscht ist und vielleicht ist jetzt auch ein extrem wichtiger Zeitpunkt, um mehr über die Russlanddeutschen, die in Deutschland leben, zu erfahren und um ihre Lebenswelten auch besser, auch im Kontext des Krieges zu verstehen.
Jannis Panagiotidis: Ich danke euch für die Einladung und die Gelegenheit, darüber zu sprechen und wir bleiben in Kontakt.
Edwin: Danke dir. Um es mit einem ukrainischen, aber auch österreichischen Wort zu sagen - baba!
Jannis Panagiotidis: Tschüss, baba.
Ira: Tschüss!