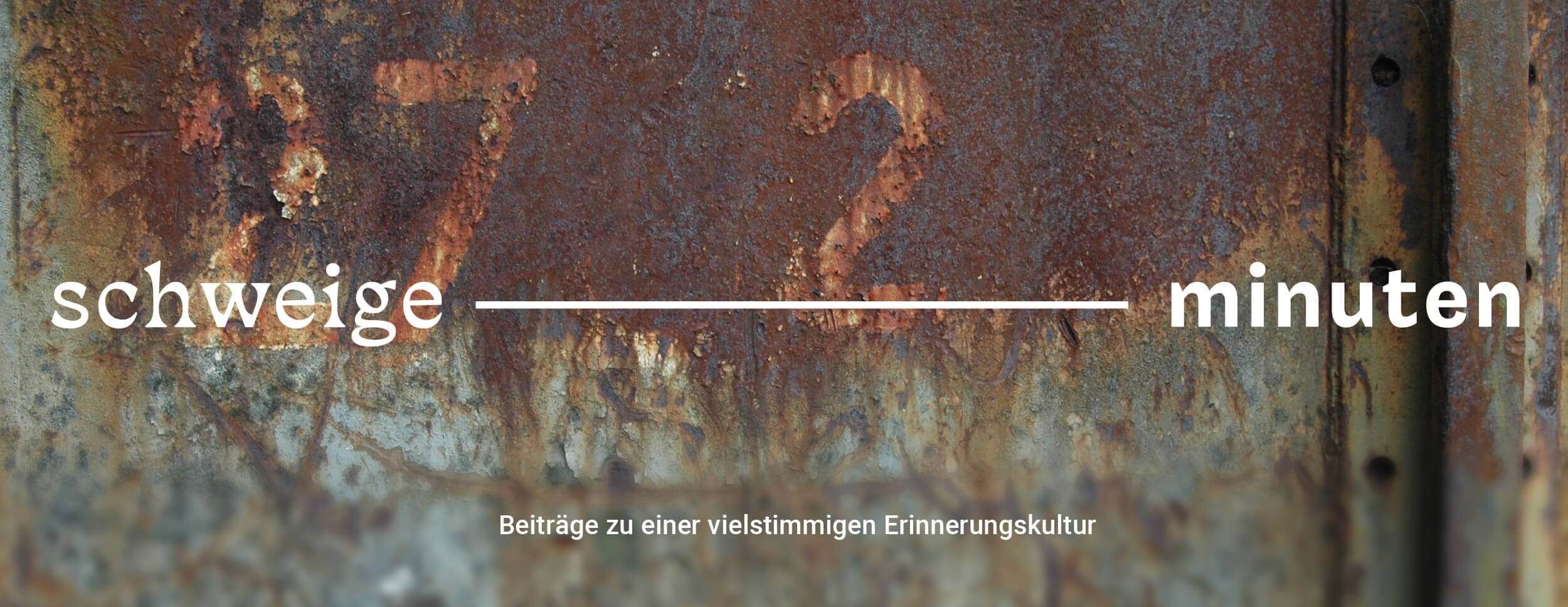
Schweigeminuten
Literarische Videobeiträge zu einer vielstimmigen Erinnerungskultur anlässlich des 80. Jahrestages der Deportation der Russlanddeutschen.
Was empfindet ein Mensch, dessen Biografie oder Familiengeschichte nicht in das offizielle geschichtliche Narrativ der Gesellschaft passt, in der er lebt? Wie können Gedenken und Erinnern Würde verleihen oder sogar Traumata bewältigen? 2,5 Millionen Bundesbürger russlanddeutscher Herkunft gedenken im Sommer 2021 an das Kriegsfolgenschicksal ihrer Eltern- und Großelterngeneration. Sieben Autorinnen und Autoren sprechen im Projekt „Schweigeminuten“ über die Bedeutung dieses Themas für die Gesamtgesellschaft und ihren persönlichen Umgang damit.
Im Juni 1941 überfällt Nazideutschland die Sowjetunion: „Unbedingt aussiedeln – mit Gewalt“ lautet Stalins Begleitnotiz unter der Vorlage zum Deportationserlass im August 1941, mit dem Bürger deutscher Herkunft, die auf seinem Territorium leben für die folgenden Jahrzehnte willkürlich und pauschal als innere Feinde gebrandmarkt werden. Für Russlanddeutsche beginnt damit das, was heute als ihr Kriegsfolgenschicksal bezeichnet wird: Verbannung, Zwangsarbeit, Sonderaufsicht. Diejenigen, denen es gelingt aus der Sowjetunion zu fliehen, werden nach Kriegsende rücküberstellt und des Vaterlandverrates bezichtigt. Es folgen auch hier: Lager, Entrechtung, Stigma.
Verdrängt und unaufgearbeitet wirkt dieses Kollektivtrauma über Generationen hinweg bis heute nach. Sprachlosigkeit und Schweigen prägten die Kommunikation vieler russlanddeutscher Familien von innen. Das Verschweigen und Verdrängen ihrer Erfahrungen bestimmte die Erinnerungskultur von außen. Am Ende der Kette stehen der Sprachverlust und das Vergessen. Das Kriegsfolgenschicksal bildete aber auch den humanitären Aufnahmegrund der davon Betroffenen in Deutschland. Warum bin ich hier, ist eine Frage, mit der sich die heutigen Generationen zunehmend laut beschäftigen. Warum sind sie hier, fragt sich ein großer Teil der Mehrheitsgesellschaft.
In der Beitragsreihe „Schweigeminuten“ stellen Eleonora Hummel, Melitta L. Roth, Artur Rosenstern, Viktor Funk, Christina Pauls, Felix Riefer und Katharina Heinrich ihre Ansichten über die verschiedenen Aspekte der Aufarbeitung dieser in der Öffentlichkeit kaum bekannten Folgen des Zweiten Weltkrieges dar. Und zwar aus der Perspektive der Nachgeborenen. In ihren essayistischen oder belletristischen Texten werfen die Autor*innen folgende Fragen auf: Was ändert sich in der Erinnerungskultur der Russlanddeutschen? Wie ist der gegenwärtige Umgang mit dem Kriegsfolgenschicksal der Großelterngeneration? Wird das Sprechen darüber von der Öffentlichkeit weiterhin lediglich als ein Opfernarrativ einer zugezogenen Personengruppe betrachtet? Kann seine Integration in die Aufarbeitungsdiskurse der Mehrheitsgesellschaft gelingen?
Das Projekt will der Ambivalenz, Komplexität, Vielfalt dieses Kapitels der deutschen Nachkriegsgeschichte Form und Sprache verleihen. Es will Wege in eine Auseinandersetzung mit einer Kollektiverinnerung nach dem Ableben der Zeitzeugen beschreiten und Möglichkeiten eröffnen, damit an die aktuellen Debatten um den gesellschaftlichen Zusammenhalt anzuknüpfen.
Ein Projekt des Kulturreferates für Russlanddeutsche und des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte Anlässlich des 80. Jahrestages der Deportation der Russlanddeutschen Idee und Konzept: Melitta L. Roth und Edwin Warkentin Kamera, Bild und Ton: Edwin Bill Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
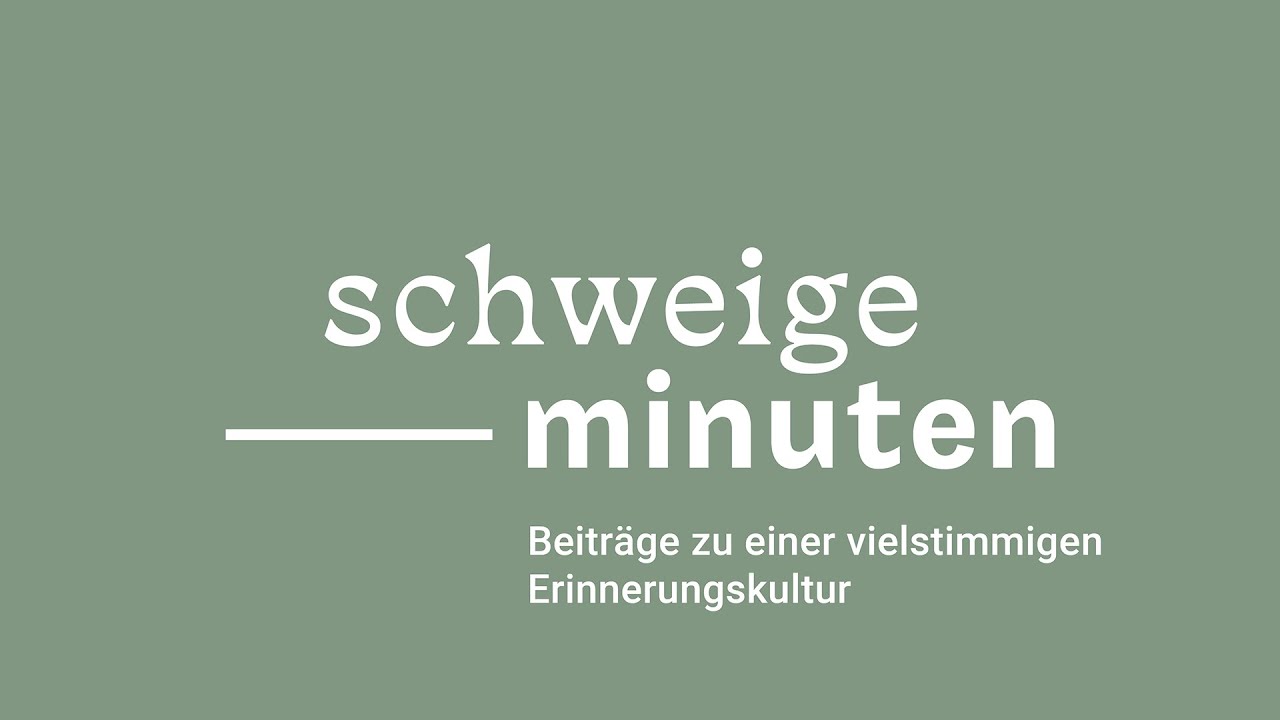 Durch Klicken werden externe Inhalte geladen und die Google-Datenschutzerklärung akzeptiert.
Durch Klicken werden externe Inhalte geladen und die Google-Datenschutzerklärung akzeptiert.





